 |
Herbert
Brün
Über Musik und zum Computer
Verlag G. Braun Karlsruhe, 1971
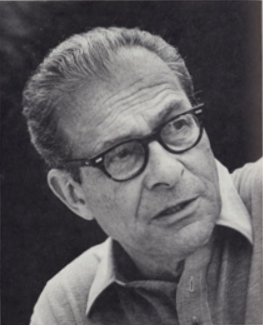
Kapitel 7: Probleme der Verständigung
Selbst noch der leugnende Scherz hat stets etwas unleugbar Vorhandenes
zum Gegenstand. Während eines Konzertes machte ein Zuhörer
über ein für ihn neues Musikstück die abfällig
gemeinte Bemerkung, daß ihn diese Klänge und Geräusche
an den Lärm der Bauarbeitein erinnerten, die ihn des Morgens
aus dem Schlafe reißen. Wenige Tage später mußte
er an einer Straßenecke ein Gespräch unterbrechen,
da in nächster Nähe, an einer Baustelle, mit ohrenbetäubendem
Krachen ein Lastwagen seine eiserne oder steinerne Ladung auf
den Arbeitsplatz schüttete. In die folgende kurze und relative
Stille drängte der im Sprechen unterbrochene Zuhörer
die scherzhaft bagatellisierende Meinung, daß das Ärgernis
ihn an die neue Musik erinnere, die wohl auch nur so zu verstehen
sei. Sowohl im Konzertsaal wie auch an der Straßenecke werden
hier gedankliche Assoziationsvorgänge für erwähnenswert
gehalten, deren private Formulierung für Kritik gehalten
werden soll. Der Inhalt ist die Voraussetzung, daß Arbeitslärm
und Musik sich voneinander unterscheiden. Die Deutung ist die
Beobachtung, daß Arbeitslärm und neue Musik sich nicht
voneinander unterscheiden. Der Scherz und sein Niveau aber werden
von folgender Überlegung bestimmt: Komponisten wollen sicherlich
keinen Arbeitslärm, sondern Musik machen. Wie lächerlich
also muß die Musik dem Komponisten mißlungen sein,
wenn der Zuhörer beim Hören dieser Musik an Arbeitslärm,
und wenn der gleiche Zuhörer beim Hören von Arbeitslärm
an diese Musik denken kann. Der Scherz leugnet, daß unter
solchen Umständen noch von Musik ernsthaft die Rede sei,
und beweist damit, daß der Zuhörer unleugbar vorhanden
ist. Der Scherz würde sich gegen den Scherzenden richten,
wenn man ihn umgekehrt interpretierte und verstehen würde,
daß der Scherz beweise, wie Musik und Arbeitslärm unleugbar
vorhanden seien, von einem Zuhörer jedoch unter solchen Umständen
nicht ernsthaft die Rede sein könnte. So einfach ist es aber
nicht. Auch ließe das Niveau des Scherzes sich derart nicht
wesentlich heben. Vorausgreifend läßt sich nämlich
absehen, wie das glossierende Talent den Zuhörer ins Absurde
befördert und ihn verärgert scherzend reflektieren läßt,
wie mißlungen doch den Arbeitern ihr Lärm sein muß,
wenn der Zuhörer dabei an Musik denken kann. Daß überall
hier und dort der Ernsthaftigkeit hämische Fallen auflauern,
liegt in der Natur jeglicher Meinungsbildung, die an der Deutung
mehr als am Gedeuteten interessiert ist. Und ein Scherz, der in
die Fallen geht, die der Ernsthaftigkeit gestellt wurden, verfällt
dem Spott. Dafür ein einfaches, allen Konzertbesuchern, Radiohörern
und Schallplattenfreunden geläufiges Beispiel: Die fünfte
Sinfonie von Beethoven.
Ein sehr populär gewordener Kommentar zu diesem Werk, besonders
auf den Beginn gemünzt, lautet: „So pocht das Schicksal
an die Pforte.“ Daher denn auch die Sinfonie oft „Schicksalssinfonie“
genannt wird. Man folge nun bitte zwei Gedankengängen. Nehmen
wir an, daß der Satz vom an die Pforte pochenden Schicksal
einst jemandem einfiel, als er unter dem gewaltigen Eindruck,
den die Sinfonie auf ihn gemacht hatte, nach einer entsprechenden
Analogie zu diesem Eindruck suchte. Fraglos standen mehrere Möglichkeiten
zur Verfügung. Die Entscheidung fiel unter dem Einfluß
der Gestalt des Hauptmotivs. Das heißt, daß nach dem
Erlebnis des ganzen Werkes, in der Erinnerung an den Anfang, dieser
sich retroaktiv zu jener gewaltigen Bedeutung entfaltet hat, die
man seiner eher primitiven und höchst lapidaren Gestalt an
sich und alleine nicht ansehen oder anhören kann und soll.
In diesem Sinne darf die Beziehung zwischen gehörtem Erlebnis
und gesprochener Analogie als ernsthafte und subjektive Beziehung
angesehen werden. Dieser Ernsthaftigkeit wird jedoch alsobald
eine hämische Falle gestellt, wenn Hörer und Dirigenten
verlangen, daß sogleich mit den ersten Takten der Sinfonie
auch das Schicksal an die Pforten poche. Wenn also insinuiert
wird, daß die vulgär-dramatische Vorstellung von Schicksalsschlägen
durch ebenso pathetische Taktschläge imitiert werden solle.
Wer, vor allem nach etwas längerem Leben, noch annimmt, daß
so das Schicksal an die Pforte pocht, dessen Ernsthaftigkeit ist
in die selbstgestellte Falle der Zitatzutraulichkeit gegangen,
worin sie mit leisem Bedauern zu besichtigen ist. Zum Gespött
schlechthin aber muß jener werden, der seine Gleichgültigkeit
gegenüber der Sinfonie zum Fortschrittsbekenntnis prägen
möchte, indem er mit ihm zeitgemäß scheinender
und kulturvertrauter Überlegenheit ganz ernsthaft scherzt:
„Da pocht mir zuviel Schicksal an die Pforte.“ Hier
geht es nicht mehr um die gehörte Sinfonie. Hier wird nur
noch das Wort, das über sie fiel, ernstgenommen und mitsamt
seinem musikalischen Hintergrund verworfen.
Es existiert ein wesentlicher Unterscheid zwischen der selbsterfundenen
Analogie, die einst den Eindruck eines musikalischen Erlebnisses
auszusprechen versuchte, einerseits, und der unselbstständigen,
von langer Hand erborgten Begriffsvermischung eines unbeeindruckten
Hörers andererseits, der mit Musik die Bedeutungslosigkeit
assoziiert, die Alltagsgeräusche für ihn haben.
Jedermann weiß, daß Verständnis und Freude nicht
stets zusammenfallen, also auch nicht identisch sind. An mancherlei
Verstandenem und Erkanntem mag die rechte Freude sich nicht einstellen.
Und mancher Freude dürfte es schwer nachzuweisen sein, daß
sie an Verstandenem sich entzündet habe. Ein Komponist, der
dies – wie jedermann – weiß, ist also bereit,
mit relativ ungerührter Liebenswürdigkeit folgende nüchternen
Bemerkungen über den Eindruck seines Werkes zu vernehmen:
„Habe die Musik verstanden. Auch hat sie mir Freude gemacht.“
–
„Habe die Musik verstanden. Hat mir aber keine Freude gemacht.“
– Habe die Musik nicht verstanden. Hat mir aber Freude gemacht.“
– „Habe die Musik nicht verstanden. Auch hat sie mir
keine Freude gemacht.“ –
Mit der, wahrscheinlich mühsam kontrollierten, Liebenswürdigkeit
des Komponisten ob so ehrlicher Nüchternheit dürfte
es aber schnell ein Ende haben, wenn folgendes Wohlwollen sich
nähert: „ Habe Freude an Ihrer Musik gehabt. Da gibt’s
nichts zu verstehen.“ – „Habe keine Freude an
Ihrer Musik gehabt. Die muß man ja verstehen.“ –
„Kann Ihre Musik verstehen. Sie macht ja Freude.“
– „Kann Ihre Musik nicht verstehen. Sie macht ja keine
Freude.“ – Der Komponist läßt sich gerne
alles über den Zuhörer und seine Eindrücke sagen,
solange der Zuhörer nicht von diesen Eindrücken auf
die Beschaffenheit der Musik schließt. Wenn die Wohlwollenden
also, auf Kosten des Verstandes, ihre privaten Freudegrade zum
Maßstab des Kunstwerkes deklarieren wollen, dann müssen
sie auch damit rechnen, daß der Komponist sich abrupt in
die unzugänglichen Gebiete seiner Kompetenz zurückbegibt,
wo er hoffen darf, auch dem wohlwollensten Sprachschatz unverständlich
bleiben zu können.
Denn ein Problem der Verständigung ergibt das andere. Zum
Beispiel kann ein unbeabsichtigt taktloses Wort den Komponisten
wie eine Beleidigung verletzen. Da Taktlosigkeit ja aber auf Unwissenheit
beruht, wird die vielleicht heftige Reaktion des Komponisten immer
als das erste Glied einer Kette von Unstimmigkeiten betrachtet,
obwohl es häufig das zweite war. Die alte Kinderfrage: „Wer
hat angefangen?“ taucht hier wieder auf. Nun, es wäre
von Fall zu Fall leicht zu klären, wer den Stein des Anstoßes
in den Weg gepflegter Konversation geschoben hat, wenn nicht ein
großer Teil der aus Unwissenheit gegangenen Taktlosigkeiten
zum wortgewordenen Kulturempfinden und zur, als gültig vorausgesetzten,
Umgangssprache gehörten. Würde es nicht für feinsinnig
und gebildet gelten, in großen Musikwerken „besonders
schöne Stellen“ zu bemerken, die man später in
Kritik, Gespräch und Erinnerung als Kunstgegenstände
anlagern kann, kein Mensch mit Takt und Erziehung würde einem
Komponisten mit der Bemerkung nahen: „Ihr Werk enthält
einige wunderbare Stellen!“, wenn er damit nicht sagen will,
daß er das Werk höchstens stellenweise genießbar
fand. Antwortet auf so etwas der Komponist: „Nennen Sie
mir die Stellen. Ich schneide sie aus und schick sie Ihnen als
Muster ohne Wert!“, so hält man ihn für hochmütig,
ungezogen, und findet es schade, daß gerade begabte Künstler
so gar keinen gesellschaftlichen Schliff haben. Der Komponist
wiederum findet es schade, daß gerade freundlich gesonnene
Hörer so gar keinen Geschmack haben und so gar kein Verständnis
dafür, daß ohne den ganzen Komponisten und ohne das
gesamte Werk die „wunderbaren Stellen“ überhaupt
keinen Wert haben.
Einige weitere und unzählige Male sich wiederholende Gelegenheiten,
bei denen Probleme der Verständigung beide Partner auf eine
harte Geduldprobe stellen, seien in schematischer Vereinfachung
und Kürze noch erwähnt.
| 1.
|
Ein Komponist
wird gebeten seine Komposition zu erläutern. Er tut es.
Danach wird ihm vorgeworfen, er habe versucht, Musik zu erklären.
|
| 2. |
Ein Komponist
wird gebeten zu erklären, was seine Musik bedeuten oder
sagen oder ausdrücken oder beschreiben oder darstellen
soll. Lehnt er es ab, wird er als Bewohner eines Vakuums oder
eines elfenbeinernen Turmes verachtet. Willfährt er der
Bitte, so wird seine Musik, als der Erklärung bedürftige,
verachtet.
|
| 3. |
Ein Komponist
wird gebeten zu erklären, wie er sein Werk komponiert
habe und was das für ihn bedeute. Er erscheint mit einem
Manifest, in dem er vorträgt, wie Musik zu komponieren
und zu verstehen sei.
|
| 4. |
Ein Komponist
wird gebeten, seine Ansichten über die allgemeinen Probleme
der zeitgenössischen Musik mitzuteilen. Er erscheint
mit einer Analyse seiner eigenen Werke.
|
| 5. |
Ein
Komponist wird aufgefordert, anläßlich der
bevorstehenden Aufführung seines neuen Werkes einen
erläuternden Kommentar für das Programmheft
zu verfassen. Erklärt er darin, was, seiner Meinung
nach, seine Musik von anderer Musik unterscheidet, so
wird die Notiz nicht angenommen, und zwar aus Gründen,
die es klar machen, daß von ihm eine Erklärung
erwartet wurde, die dartun soll, wie nichts seine Musik
von anderer Musik unterscheide.
|
Derlei ließe
sich noch vieles anführen. Es wäre aber recht oberflächlich,
würde man von solchen Vorkommnissen nur auf die Leute schließen
und nicht auch auf die Sprache, würde man einfach für
den einen oder anderen Partei nehmen und das Mittel, das beiden
gemeinsam ist und undiskriminierend sich beiden zur Verfügung
stellt, nicht einer Prüfung auf seine Gültigkeit in
jedem einzelnen Falle unterziehen.
Hier und dort handelt es sich um gestörte Kommunikationsketten.
Es sollte interessieren, daß in Meyer-Epplers schon oft
zitierten Buch über Informationstheorie nicht nur das elfte
Kapitel, worin es um die Sprache geht, mit der Überschrift:“
Die gestörte sprachliche Kommunikation“ versehen ist,
sonders daß schon im ersten Kapitel, über die elementaren
Kommunikationsketten, der gestörten Kommunikationskette viel
Raum gewidmet wird. Es will scheinen, daß die Störung,
die beim Laien meist eine unmutig abwinkende Reaktion provoziert,
den wissenschaftlich Forschenden eher fasziniert. Das ist einfach
zu erklären. Der Wissenschaftler, ja jeder denkende Mensch
weiß, daß jegliche Information, also alles unerwartet
Neue, oder unerwarteterweise Bestätigte, eine Störung
der Selbstverständlichkeit des bis dahin Gewußten ist.
Die Umkehrung dieses Satzes ist offenbar ein Risiko. Nicht jeder
Störung entpuppt sich bei näherer Untersuchung als Information.
Immerhin hat sich laut höchst kompetenter Stellen das Risiko
gelohnt. Unter sorgfältig vorbereiteten Versuchsanordnung
sind Störungen beinahe immer informationsträchtige Hinweise.
Meyer-Eppler formulierte es so: „Ob die vom Expedienten
intendierte Mitteilung vom Perzipienten verstanden wird, hängt
davon ab, an welchen Stellen und in welchem Ausmaß die verschiedenen
Glieder der Kommunikationskette Störeinflüssen ausgesetzt
sind. Störungen können sowohl an den zugänglichen
wie auch an den unzugänglichen Stellen der Kommunikationskette
erscheinen, sowohl im Bereich der Signale wie auch im Bereich
der Zeichen auftreten, und so die Beobachtung, die Diagnose oder
die sprachliche Verständigung erschweren oder gar verhindern.
Alle Maßnahmen, die zu einer Verminderung von Störungseinflüssen
beitragen, sollen unter dem Oberbegriff Anpassung zusammengefaßt
werden. Bei der sprachlichen Kommunikationskette ist sorgsam zwischen
der Signalanpassung und der Zeichenanpassung zu unterscheiden;
beide zusammen erst bewirken die möglichst verlustarme Informationsentgegennahme.“
Am Schluß des zitierten Abschnitts findet sich noch eine
Mitteilung, daß die Informationstheorie, eine rein mathematische
Theorie, Methoden bereitstellt, die gestatten, die Wirkung von
Störungen auf den Informationsgehalt, der in der semantischen
Sphäre übermittelt werden sollen, quantitativ zu beschreiben,
ohne auf Art und Wesen der Störungen eingehen zu müssen.
Da aber gerade Art und Wesen der Störungen uns hier mehr
angehen als ihre quantitative Beschreibung, verlassen wir wieder
die soliden Bahnen Meyer-Epplers und der Wissenschaft, erinnern
uns aber, daß alle Maßnahmen, die zu einer Verminderung
von Störeinflüssen beitragen, unter dem Oberbegriff
„Anpassung“ zusammengefaßt werden sollen.
Wie soll ein Komponist sich also verhalten, wenn er mit viel Mühe
und Lust eine Musik komponiert hat, die, wie er hofft, etwas Unerhörtes,
Neues, Informatives, kurz: viele Störungen des schon Selbstverständlichen
vermittelt und nun die Bestätigung seiner Leistung in Form
eines empörten Vorwurfs erfährt? Wie soll zwischen beabsichtigter
Störung und erlittener Störung die Anpassung gefunden
werden? Es sei nun ein Aspekt des Problems vorgeführt, der
zeigen soll, daß die Behauptung, der Hörer habe sich
anzupassen, keiner Unverschämtheit des Komponisten das Wort
redet, sondern dem Wesen des Problems entspringt.
Würde der Komponist seine Absicht, zu stören, aufgeben,
so gelänge ihm nur noch bedeutungslose Musik, das heißt,
die Anpassung fände statt, bevor ein störendes Geschehen
dafür sorgen konnte, die Kommunikationskette zwischen Hörer
und Komponisten beiden, sei es auch als gestörte, ins Bewußtsein
zu bringen. Fehlt aber das Bewußtsein von einer musikalischen
Kommunikationskette, so gibt es keinen Grund mehr, der vorhandenen
Musik irgendwelche weitere oder andere hinzuzufügen Der Beruf
des Komponisten würde in solchen Fällen in Ermangelung
wahrnehmbarer Berufung eingehen.
Für den Hörer sieht es interessanter aus. Gelingt es
ihm, dem Störenden den Stachel dadurch zu nehmen, daß
er die Störung als überwindbar durchschaut, so nur deshalb,
weil er begreift, daß zeitgenössische Kunst eben nicht
aus gestörten Mitteilungen, sondern aus mitteilsamen Störungen
bestehen muß. Er kann die Störung als Mitteilung empfangen.
Das bedeutet Anpassung, nachdem etwas die Kommunikationskette
zwischen Hörer und Komponisten, und sei es auch als gestörte,
beiden ins Bewußtsein gebracht hat.
Der Komponist hat nur die Wahl, ob er Komponist sein will oder
etwas anderes. Der Hörer kann sich aussuchen, ob oder was
er hören will. Er bleibt Hörer, ob er sich dem Nichtgeschehen
oder dem Geschehen anpaßt. Der Komponist kann sich nicht
anpassen, ohne seine Existenz als Komponist zu opfern, und statt
dessen ein tonsetzender Arrangeur zu werden. Er muß, koste
es was es wolle, seine Mitteilungsabsicht solchen musikalischen
Vorgängen anvertrauen, deren Störungseinfluß bis
dahin von möglichst wenig Anpassungsmethoden vermindert wurde.
Solche musikalischen Vorgänge sind schwer zu erfinden und
schwer zu kombinieren. Darin liegt die Arbeit des Komponierens,
wenn es dem Komponisten um eine musikalische Mitteilung geht.
Häufig sagen solche professionellen Hörer, die einen
guten Komponisten nicht von einem schlechten unterscheiden können,
beiden nach, daß sie versucht hätten, um jeden Preis
neu zu sein. Offenbar haben beide Werke nicht dem Anpassungsvermögen
der Nachsager entsprochen. Tatsächlich versucht ein guter
Komponist, eine Musik zu schreiben, die um jeden Preis da ist,
und sei der Preis auch der Verzicht auf alles, was, auch von ihm
geliebt, schon da war. Was neu gefunden wird, ist oft der Preis,
um den es überhaupt gefunden werden kann.
Vor bald 200 Jahren schrieb Mozart an seinen Vater einen Geburtstagsbrief:
„Allerliebster Papa!
Ich kann nicht poetisch schreiben; ich bin kein Dichter. Ich kann
die Redensarten nicht so künstlich einteilen, daß sie
Schatten und Licht geben; ich bin kein Maler. Ich kann sogar durch
Deuten und durch Pantomime meine Gesinnungen und Gedanken nicht
ausdrücken; ich bin kein Tänzer. Ich kann es aber durch
Töne; ich bin ein Musikus... Nun muß ich mit einer
musikalischen Gratulation schließen. Ich wünsch Ihnen,
daß Sie so viele Jahre leben möchten, als man Jahre
braucht, um gar nichts Neues mehr in der Musik machen zu können.“
So heiter und launig der Brief wohl ist, so schwer dürfte
es auch dem gierigsten Ohre sein, darin Schwingen des Genies rauschen
zu hören. Der Brief wurde hier zitiert, um zu zeigen, mit
welcher Selbstverständlichkeit für Mozart ein Musikus
der Mann ist, der Neues in der Musik machen will und kann. Und
mit welcher Selbstverständlichkeit Mozart Neues in der Musik
erwartet, indem er sie zum Maße der Lebensdauer nimmt, die
er seinem Vater wünscht. Derselbe Mozart, auf den sich viele
Musikfreunde berufen, die heute in der Musik nichts Neues mehr
für möglich und erträglich halten.
Ein brauchbarer Befund, dessen Richtigkeit sorgfältig und geduldig zu prüfen wäre, könnte etwa so lauten: Die wesentlichen Probleme der Verständigung zwischen Hörer und Komponisten sind beabsichtigte und planend durchdachte Störungen einer Kommunikationskette, die bliebe sie ungestört, leerlaufen oder zerreisen würde. Die wesentlichen Probleme der Verständigung verbauen nirgends, auch in der Musik nicht, den Zugang zu beabsichtigten Mitteilungen, sondern sie sind der Zugang selbst. Jede Kultur mißt sich an der Menge und Bedeutung der Probleme der Verständigung, die sie als solche erkennen und lösen konnte. Jede Musik, die ein solches Problem stellt, ermöglicht einen weiteren Akt der Erkenntnis und der Lösung, ermöglicht eine neue und das gegenwärtige Leben betreffenden Verständigung, und somit eine Vermehrung dessen, woran der Gesellschaft es noch allenthalben zu fehlen scheint. Die unwesentlichen Probleme der Verständigung, die mehr privaten und emotionellen, sind lediglich Symptome des Fehlens.
  

Index

.
The
Early Years | Inside '99
| Ereigniswelt | Business
Art
Gästebuch
| Kontakt | Credits
| Start
..

.
Die Synthesizerstudio Bonn History
 = Popup-Fenster
(JavaScript aktivieren!) = Popup-Fenster
(JavaScript aktivieren!)
©2001
|
 |